Forschungsbereiche
Soziale Ungleichheit betrifft uns alle, weltweit. Am ISI wird sie nicht nur erforscht, sondern aktiv hinterfragt. Durch internationale Zusammenarbeit, innovative Förderprogramme und eine klare Haltung: Forschung muss Wirkung zeigen.







Ungleichheit neu denken: Globale Forschung mit Wirkung
Soziale Ungleichheit betrifft uns alle, weltweit. Am ISI wird sie nicht nur erforscht, sondern aktiv hinterfragt. Durch internationale Zusammenarbeit, innovative Förderprogramme und eine klare Haltung: Forschung muss Wirkung zeigen. Das ISI vernetzt Wissenschaftler:innen aus aller Welt, fördert den interdisziplinären Austausch und setzt Impulse für eine gerechtere Zukunft. Mit Förderungen wie dem Visiting Fellowship und dem Pipeline-Programm stärkt das Institut gezielt junge Talente und baut Brücken zwischen Generationen, Disziplinen und Kontinenten. Wissenschaft bleibt am ISI nicht im Elfenbeinturm: Forschungsergebnisse werden verständlich aufbereitet und in politische, zivilgesellschaftliche und öffentliche Debatten eingebracht. Denn echte Veränderung beginnt mit Wissen – das geteilt wird.
Das sind unsere Forschungsbereiche:
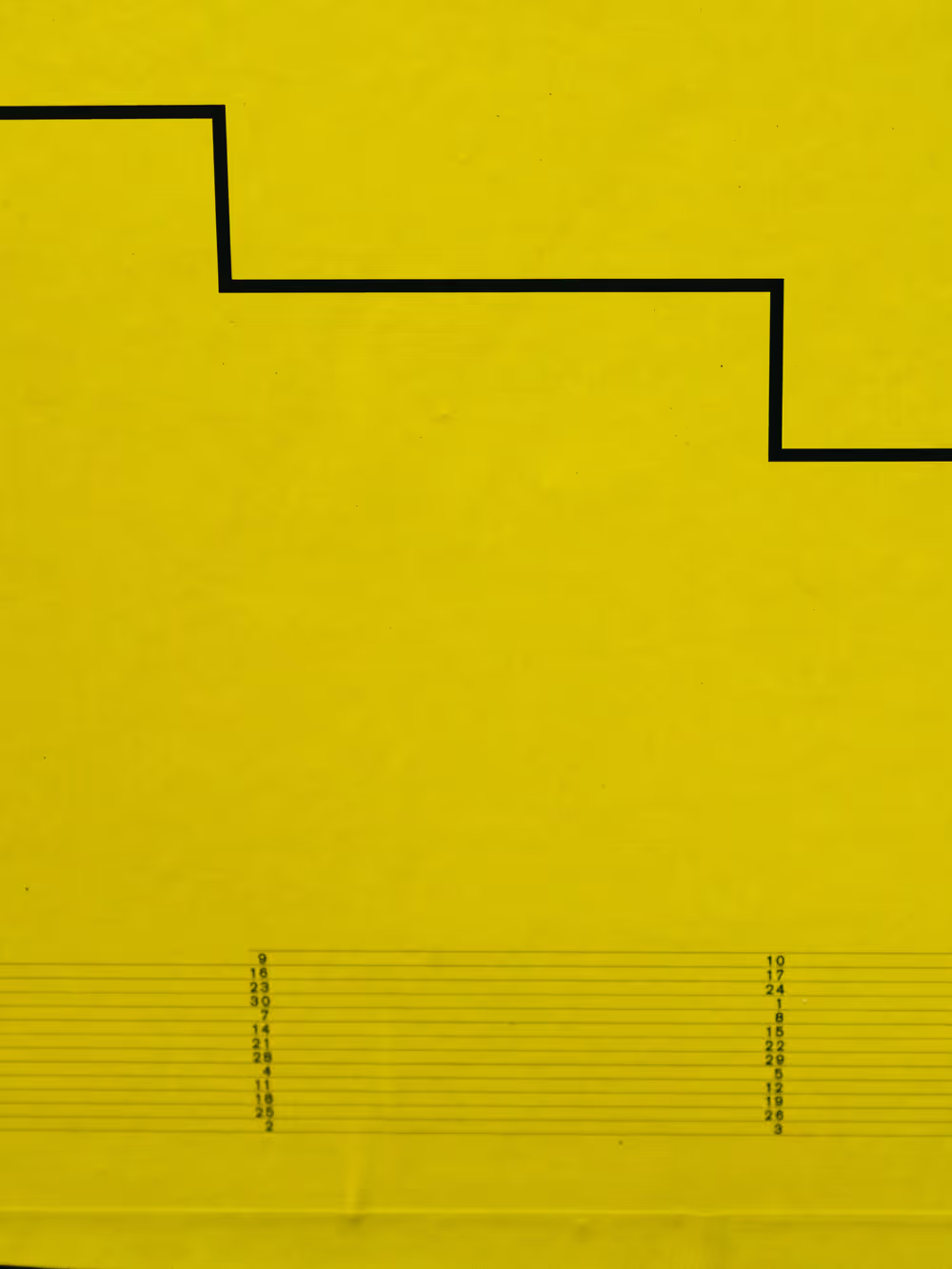
Grundlagenforschung zur Sozialen Ungleichheit
Wir untersuchen sozioökonomische Ungleichheit, besonders Vermögenskonzentration, und wollen zentrale Erkenntnisse zu Ausmaß, Ursachen und Folgen gewinnen – interdisziplinär und international.

Vergleichende Forschung und Reale Utopien
Wir erforschen alternative Politiken und Institutionen, die Ungleichheit verringern und das Wohl aller fördern sollen. Dabei kombinieren wir eine „real-utopische“ Perspektive, die scheinbar idealistische, aber praktikable Ansätze prüft, mit vergleichender Sozialforschung, die internationale und historische Erfahrungen analysiert.
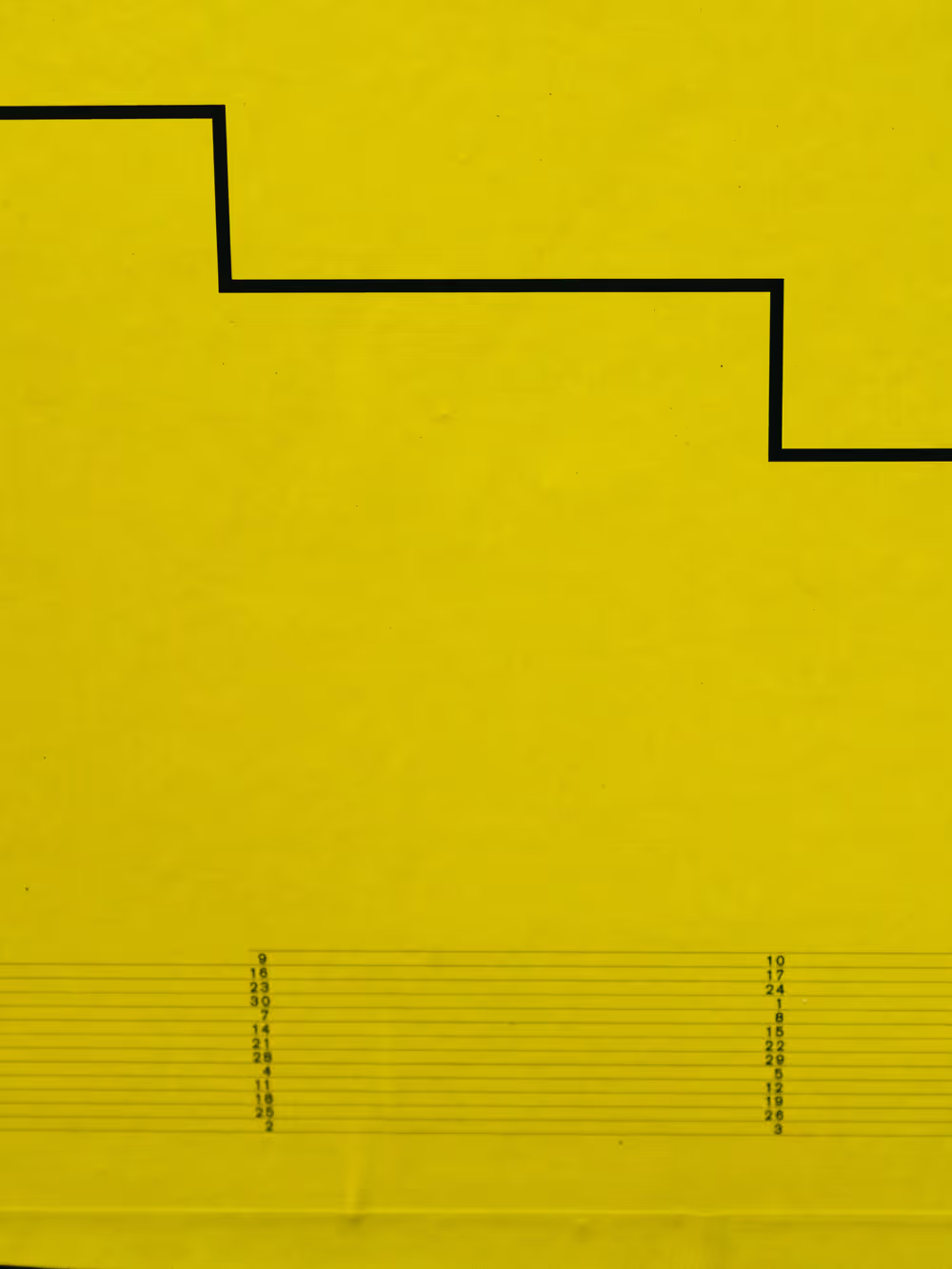



Dateninfrastruktur für Ungleichheitsforschung
Wir nutzen vielfältige Daten, besonders Steuer- und administrative Daten, um Ungleichheit individuell zu analysieren. Am ISI fördern wir deren Erforschung und bauen ein weltweites Netzwerk von Forschenden auf.

Grundlagenforschung zur Sozialen Ungleichheit
Wir erforschen verschiedene Dimensionen der sozioökonomischen Ungleichheit, mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Vermögenskonzentration. Unser Ziel ist es, grundlegende Erkenntnisse über Ungleichheit – deren Ausmaß, Trends, Determinanten und Konsequenzen – zu gewinnen. Wir verfolgen einen interdisziplinären und internationalen Ansatz, der auf unterschiedlichen Perspektiven und Methoden basiert, um unser Verständnis für dieses komplexe Thema zu vertiefen.

Dateninfrastruktur für Ungleichheitsforschung
Die Analyse von Ungleichheit basiert auf einer Vielzahl von Datentypen. Zu den jüngsten bedeutenden Fortschritten in diesem Bereich haben administrative Datenquellen, einschließlich von Steuerdaten, beigetragen, die oft in Kombination mit anderen Datensätzen verwendet werden. Am ISI setzen wir uns dafür ein, die Erforschung von Steuerdaten und anderen administrativen Quellen für individualisierte Analysen von Ungleichheit voranzutreiben. Zudem streben wir an, die internationale Gemeinschaft von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die an ähnlichen Forschungsprojekten arbeiten, weltweit zu erweitern.

Vergleichende Forschung und Reale Utopien
Wir untersuchen alternative Politiken und Institutionen, die darauf abzielen, Ungleichheit zu verringern und das menschliche Wohlergehen für alle zu fördern. Unser Ansatz nutzt zwei komplementäre Perspektiven: Zunächst nehmen wir eine „real-utopische“ Perspektive ein, die politische Interventionen oder institutionelle Alternativen betrachtet, die auf den ersten Blick idealistisch erscheinen mögen, sich bei näherer Betrachtung jedoch als tragfähig erweisen können.
Das bedeutet, dass wir sozialwissenschaftliche Methoden anwenden, um zu bewerten, was in der Praxis funktionieren könnte, unabhängig von der aktuellen politischen Umsetzbarkeit. Oft erscheinen Alternativen utopisch, weil unsere Sichtweisen durch den vorherrschenden Status quo unserer Zeit und unseres Ortes geprägt sind. Zweitens engagieren wir uns in der vergleichenden Sozialforschung und nutzen sowohl internationale als auch historische Vergleiche, um die Erfolge und Herausforderungen von Alternativen zu bestehenden Politiken und Institutionen zu dokumentieren.